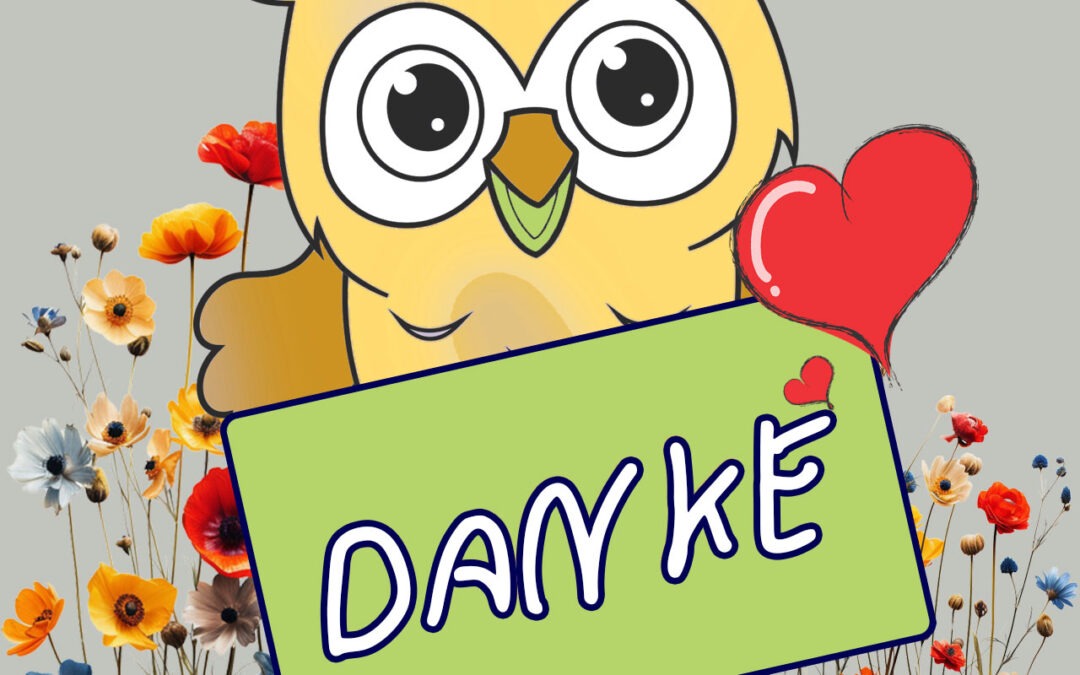Brücke soll Infrastruktur verbessern
Brücke soll Infrastruktur verbessern
Die Verkehrsbelastung in Degerschlacht hat längst ein unerträgliches Maß erreicht. Besonders Fußgänger stehen vor Herausforderungen, wenn sie die stark befahrene Leopoldstraße überqueren möchten, um die lokalen Geschäfte wie die Bäckerei und den Metzger zu erreichen. Doch nun gibt es Licht am Ende des Tunnels: Mit einer spannenden Infrastrukturmaßnahme will die Gemeinde die Verkehrssituation entschärfen und für mehr Barrierefreiheit sorgen.
Bei uns in Degerschlacht ist der Verkehr unerträglich geworden. Den größten Teil der Fahrzeuge macht der Durchgangsverkehr aus. Für Fußgänger, die zum Bankautomaten der Sparkasse wollen, bevor sie zum Bäcker gehen, wird das Überqueren der Straße trotz Ampel immer wieder zu einer großen Herausforderung.
Überqueren der Straße bleibt trotz Ampel Herausforderung
Die Bäckerei akzeptiert inzwischen zwar bargeldlose Zahlungen, selbst bei geringen Beträgen wie beispielsweise für eine Vesper-Brezel, die Eltern ihren Kindern zur Schule oder in den Kindergarten mitgeben möchten. Damit soll den Kunden der Weg über die Leopoldstraße erspart bleiben. Doch wer anschließend noch zum Metzger möchte oder von dort kommt, muss dennoch die Leopoldstraße überqueren.
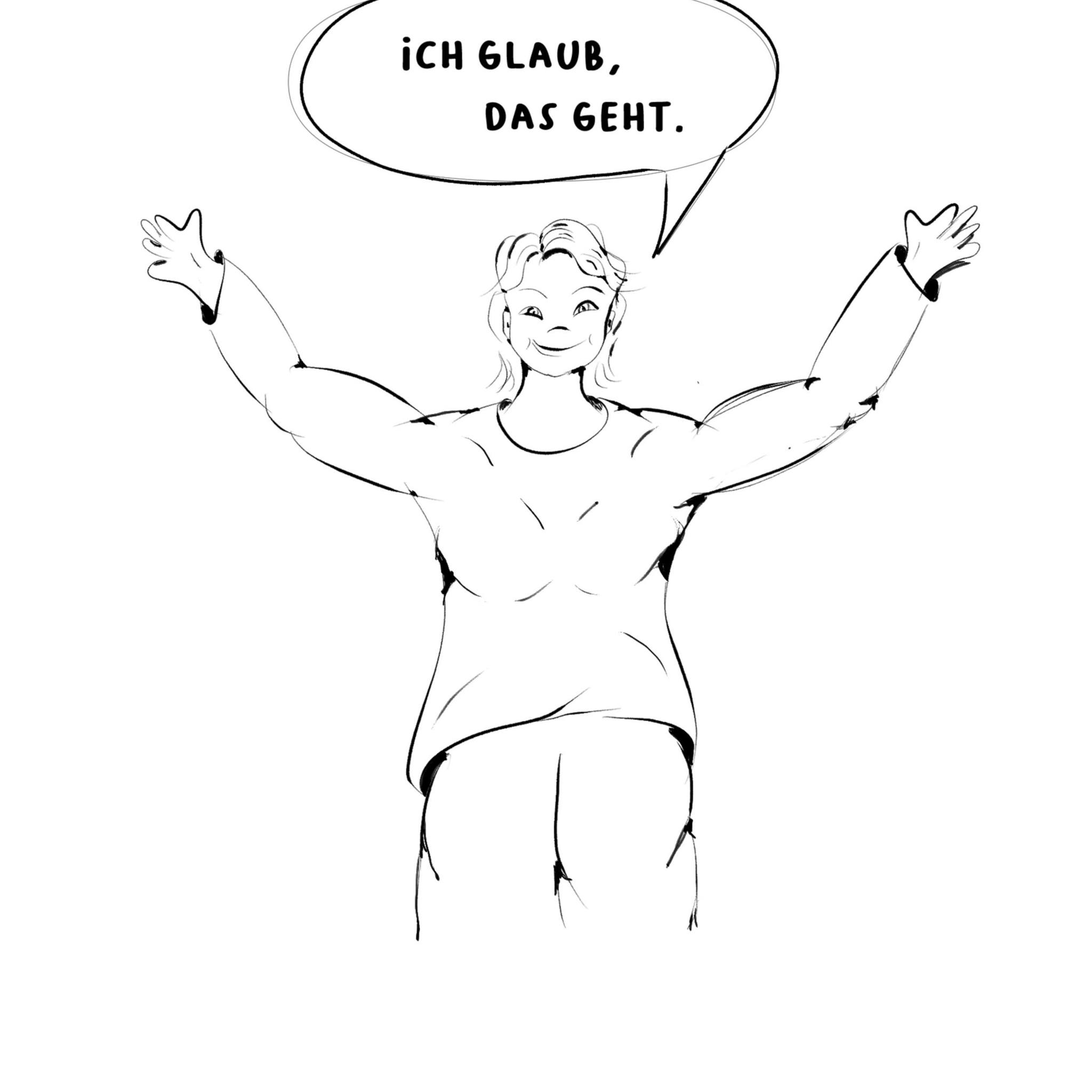

Finanziert aus 900 Milliarden Sondervermögen
Da die Bundesregierung die jüngst freigegebenen 900 Milliarden Euro auch für die Infrastruktur verwenden will, wird auch Degerschlacht hier längst überfällige Baumaßnahmen umsetzen, die es Fußgängern künftig erleichtern sollen, mit den Einwohnern auf der anderen Seite der Leopoldstraße in Kontakt zu treten. Außerdem soll es allen ermöglicht werden, sowohl Bäcker als auch Metzger barrierefrei zu erreichen.
Fertigstellung zum
1. April 2026
Die Bauarbeiten für eine Fußgängerbrücke über die Leopoldstraße sollen noch in diesem Jahr beginnen. Mit der Fertigstellung wird bis zum 1. April 2026 gerechnet. Ursprünglich hatte man über eine Entschärfung des Verkehrs mithilfe eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Leopoldstraße/Martin-Knapp-Straße/Talstraße nachgedacht. Doch diese Idee wurde wieder verworfen, da dafür die Kirche hätte versetzt werden müssen.